Posted on Februar 27, 2019 by Florian Kühl -

Im Rahmen des landeskirchlichen Themenjahres „Zeit für Freiräume 2019“ bieten die Evangelische Akademie Loccum und der Sprengel Hannover kirchlichen Gruppen und Teams einen Freiraum zur Ausarbeitung einer Idee oder eines Vorhabens: etwas, das die Kirche oder ihre Einrichtungen, ihre Theologie, die Kirchenmusik, den Gemeinde-Kindergarten voranbringt oder auf den Kopf stellt. Im Kirchen-Experiment „24h-Freiraum“ erhalten bis zu 12 Personen kostenfreie Unterkunft und Verpflegung, um sich gemeinsam 24 Stunden lang mit einem selbst gewählten Thema auseinander- setzen können.
Bitte finden Sie hier die Presse-Information zum Thema
Bitte finden Sie hier den Ausschreibungstext
Posted on Mai 27, 2021 by Florian Kühl - Tagungsrückblick
Posted on Juni 10, 2025 by ealadmin -
Abbreviations
Introduction
Tobias Flessenkemper
Thomas Müller-Färber
Adis Merdžanović
A Sustainable European Integration Policy for the Western Balkans?
Testing Five Common Assumptions
Matteo Bonomi
Integrating the Western Balkans into the EU: A region of risks or region of opportunities?
Gesa Bent
Dealing with the Past: How to Increase the Impact of Reconciliation and Transitional Justice Efforts?
Carla Schraml,
Kristina Ćorić
Ethnicised politics and everyday life in Mostar and the Region. How can mediation, dialogue, and improved political communication and contribute to weaken it?
Zarije Seizović
Transitional Justice in an unjust Country
A quarter of a century later…
Đuro Blanuša
A Better Region Starts with (You(th)
Marika Djolai
The bitter Battles and sweet Victories in the Balkans. Bilateral Disputes Theatre
Ulrike Lunacek
Zehn Jahre Republik Kosovo –
Erfolge, Herausforderungen, Perspektiven im europäischen Kontext
Igor Novakovic
Western Balkans and the Influence of Third States
Marco Trosanovski
Macedonia momentum:
from captured stated to…?
Theresia Töglhofer
Crisis in the Western Balkans:
How Can Europe Do More?
Conference report
Posted on März 28, 2022 by Florian Kühl -

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine markiere eine „Zeitenwende“ – so Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner Regierungserklärung am 27. Februar. Seitdem werden wir täglich überrascht von neuen politischen Wendungen: Scholz bewilligte im Handumdrehen 100 Milliarden Euro zusätzlich für die Nachrüstung der Bundeswehr. Die Bundesrepublik liefert militärische Abwehrwaffen in ein Kriegsgebiet. Die Grüne Außenministerin Baerbock kündigt eine Nationale Sicherheitsstrategie an – unsere Sicherheit wird nun nicht mehr nur am Hindukusch, sondern in der gesamten vernetzten Welt verteidigt. Die EU will bis 2025 eine gemeinsame Eingreiftruppe von rund 5.000 Soldatinnen und Soldaten aufstellen – und Deutschland wird als erstes Land die Führung übernehmen.
Eine „Zeitenwende“ deutscher Politik ist dies jedoch nicht: Die begann bereits mit der deutschen Beteiligung an den Luftangriffen der NATO im Kosovo-Krieg 1999 – ein Kampfeinsatz, für den es nicht einmal ein UN-Mandat gab. Damals war Joschka Fischer (Grüner!) Außenminister. Es war der erste Kampfeinsatz deutscher Soldaten nach dem Zweiten Weltkrieg. Weitere Einsätze kamen hinzu: So folgte Deutschland den USA in den Einsatz nach Afghanistan. Mit rund 3.000 Soldatinnen und Soldaten ist die Bundeswehr derzeit auf drei Kontinenten an elf Einsätzen beteiligt: Als Teil der KFOR-Truppen im Kosovo, in Jordanien und dem Irak im Kampf gegen den „Islamischen Staat“, als Teil der NATO-Sicherheitsoperation „Sea Guardian“ im Mittelmeer, im Rahmen der „European Union Training Mission“ in Mali, mit der UN im Libanon, mit der EU am Horn von Afrika, bei UN-Missionen im Südsudan und in der Westsahara. Die Militärausgaben sind zwischen 2005 und 2020 kontinuierlich angestiegen: von 33,3 Milliarden US-Dollar 2005 auf 52,8 Milliarden US-Dollar 2020. Das Volumen der Rüstungsexporte stieg gar von gut fünf Milliarden Euro im Jahr 2009 auf 9,35 Milliarden Euro im Jahr 2021. Anstatt einer „Zeitenwende“ sehe ich eher eine sich verstetigende Kontinuität in Deutschlands Unterstützung der Rüstungsindustrie. Und ein deutlicheres Bekenntnis zu militärischen Einsätzen.
In unserer Tagungsreihe „Friedenseinsätze…“ werden militärische Interventionen der vergangenen Jahre und Jahrzehnte kritisch hinterfragt: Was wurde daraus gelernt – und was nicht? Die bittere Wahrheit ist: Keiner der oben erwähnten Einsätze der Bundeswehr hat bisher zu einem dauerhaften Frieden in einer Weltregion geführt. Der Rückzug aus Afghanistan, der für die einheimische Bevölkerung katastrophale Folgen nach sich zieht, bildet nur die Spitze des Eisbergs aus bleibendem Unfrieden.
„Aus Gottes Frieden leben – Für gerechten Frieden sorgen“, so lautet der Titel der EKD-Friedensdenkschrift aus dem Jahr 2007. Sie verwirft Friedenssicherung durch nukleare Abschreckung und gibt der zivilen Konfliktbearbeitung eindeutig Vorrang vor militärischen Interventionen. Sie fordert präventives Handeln für die Förderung eines nachhaltigen Friedens und die Stärkung ziviler Friedens- und Entwicklungsdienste. Damit sollte eine „Zeitenwende“ eingeleitet werden, in der Krieg keine Option mehr ist.
Ist diese Friedensethik nun am russischen Angriff auf die Ukraine gescheitert?! Waren die politischen Bemühungen um Versöhnung nach dem Zweiten Weltkrieg, das jahrzehntelange ökumenische Engagement für eine Transformation christlicher Ethik – weg von der Rechtfertigung für einen „gerechten Krieg“ und hin zum Einsatz für einen „gerechten Frieden“ – denn vergeblich?!
Ich glaube nicht. Der russische Angriffskrieg ist völkerrechtswidrig und durch nichts zu rechtfertigen. Dennoch müssen meines Erachtens die fortgesetzte – neue! – Blockbildung und die ebenfalls fortgesetzten Investitionen in Kriegsmaschinerie kritisch hinterfragt werden. Den deutschen Militärausgaben in Höhe von fast 53 Milliarden US-Dollar steht dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ein Etat von gerade einmal 12 Milliarden Euro gegenüber. Präventive Arbeit für einen gerechten Frieden auch finanziell deutlich stärken, die Erkenntnisse aus der Entwicklungszusammenarbeit in UN-Friedenseinsätze übertragen, energiewirtschaftliche Abhängigkeiten von autoritären Staaten entschieden beenden und damit den Oligarchien die Machtbasis entziehen – das wäre eine „Zeitenwende“, die den Namen verdient! Dafür sollten sich auch die Kirchen mit ihrer wirtschaftlichen Kraft einhellig einsetzen und so ihre Friedensethik mit kräftigen Taten unterstützen. Die evangelischen Positionen zur Friedens- und Sicherheitspolitik werden übrigens in einer Expertinnen- und Expertentagung vom 1. bis 2. April 2022 an der Evangelischen Akademie Loccum diskutiert.
In der Kolumne „Hinterfragt“ veröffentlicht Akademiedirektorin PD Dr. Verena Grüter ihre persönliche Sicht der Dinge.
Posted on April 22, 2022 by Florian Kühl -

Am 10. Mai 2022 lädt das Nationale Begleitgremium ein zum Thema „Was geht die Kirchen die Endlagersuche an? Kirchliche Akteure als Teil der Zivilgesellschaft“. Monika C.M. Müller, Studienleiterin an der Evangelischen Akademie Loccum für Naturwissenschaften, Ökologie und Umweltpolitik, ist Mitglied im Nationalen Begleitgremium. Es soll die Endlagersuche für hoch radioaktive Abfälle vermittelnd – und das heißt: unabhängig, transparent und bürgernah begleiten.
Das Thema Kirchen und Kernenergie hat eine längere Geschichte. Bereits seit 1987 formuliert die Synode der EKD ihre ablehnende Haltung gegenüber dieser Form der Energiegewinnung, weil diese nicht mit dem biblischen Auftrag der Bewahrung der Erde zu vereinbaren sei. Deshalb sollte so bald wie möglich auf erneuerbare Energieträger umgestiegen werden. Die Synode hat diese Auffassung 1998, 2006 und erneut 2008 bestätigt.
2010 forderte die 11. Synode der EKD die Bundesregierung dazu auf, zu dem im Atomkonsens 2001 vereinbarten Zeitplan zum Ausstieg aus der Kernenergie zurückzukehren. Ebenso fordert sie, mehrere Standorte in der BRD parallel und ergebnisoffen auf Tauglichkeit für ein Endlager zu erkunden.
Der Landesbischof der Ev.-Luth. Landeskirche Hannovers nahm als Repräsentant einer gesellschaftlich relevanten Gruppe, der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), an der Endlager-Kommission (2014 – 2016) aktiv teil. Seit 2017 ist in Deutschland die Endlagersuche, d.h. die Standortauswahl für ein Endlager für hochradioaktive Abfälle, neu aufgesetzt. Die Standortsuche soll wissenschaftsbasiert, transparent, lernend und partizipativ verlaufen, eine breite Öffentlichkeit früh einbezogen werden.
„Ein gesellschaftlicher Konsens ist nötig, damit später Betroffene die Entscheidung für einen Standort akzeptieren“, sagte 2020 Landesbischof Ralf Meister beim ersten „Begleitforum Endlagersuche Niedersachsen“ in Hannover. Und: „Der Mensch muss dauerhaft Verantwortung für das übernehmen, was er der Schöpfung angetan hat“ (evangelisch.de 29.9.2020).
Wie aber verhalten sich die Kirchen nun bei der Endlagersuche? Spüren kirchliche Vertreterinnen und Vertreter eine Verantwortung in dieser Angelegenheit – auch unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit? Was erwarten sie an Betroffenheit in der Zukunft, wenn die Regionen eingegrenzt und Gemeinden stärker betroffen sein werden?
Die Online-Veranstaltung soll diese Fragen in dem Mittelpunkt rücken und dazu dienen, eine kirchliche Haltung zu identifizieren oder die Notwendigkeit der Bildung einer solchen aufzeigen.
Bitte finden Sie hier das Programm und den Flyer zur Veranstaltung
Sie können sich hier zur Veranstaltung anmelden.
Posted on April 22, 2022 by Florian Kühl - Tagungsrückblick
Posted on November 16, 2021 by Florian Kühl - Tagungsrückblick
Posted on November 16, 2021 by Florian Kühl - Tagungsrückblick







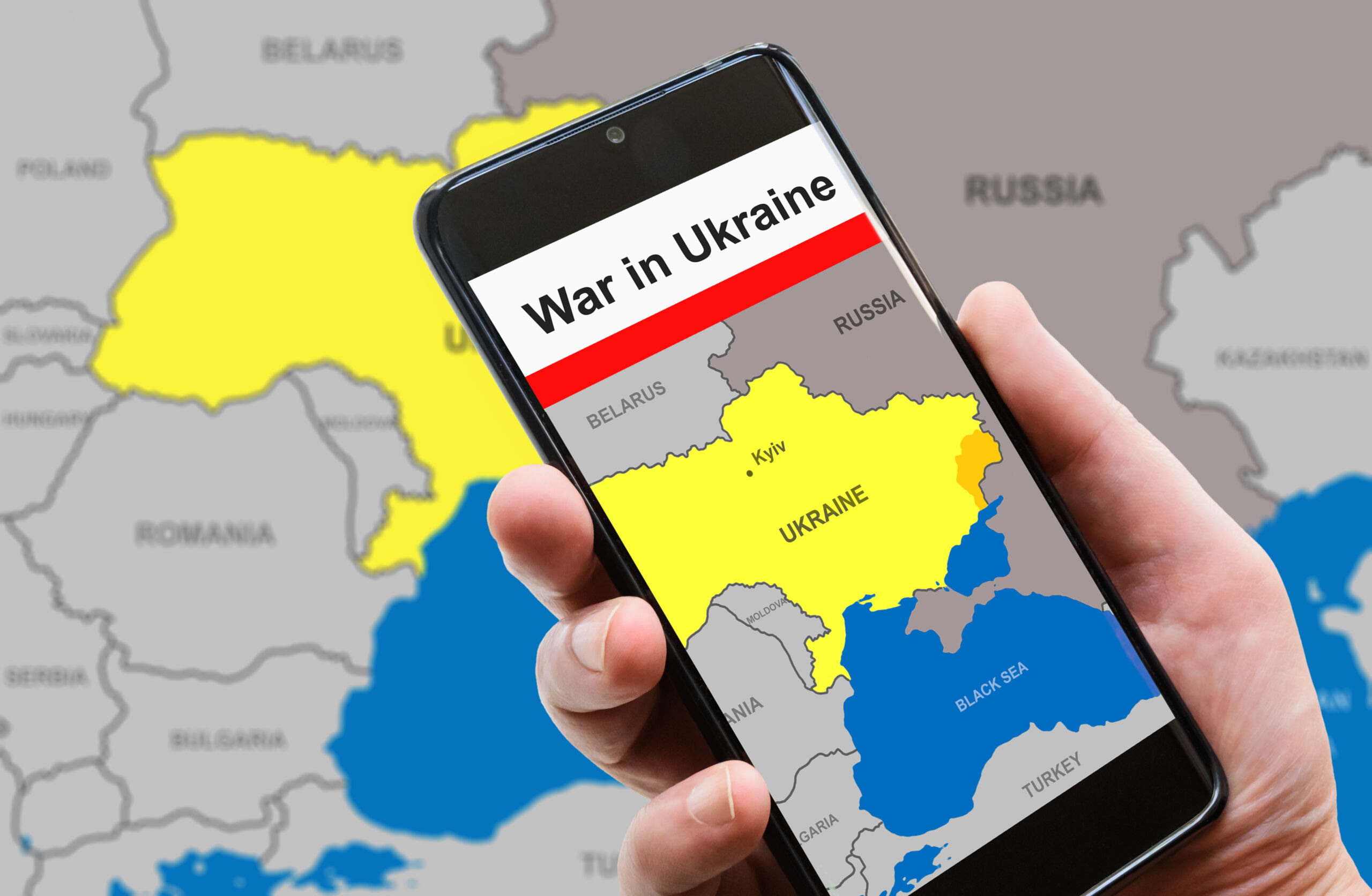


Neueste Kommentare